| Dörfliche Siedelung und bäuerliches Gehöft dienen
in erster Linie wirtschaftlichen, insbesondere landwirtschaftlichen
Zwecken. Man sollte daher annehmen, daß für ihre Formen die Art und
Weise des landwirtschaftlichen Betriebes allein maßgebend wäre. Das
ist aber, wie die Forschung gezeigt hat, in so ausschließlicher
Weise keineswegs der Fall. Daneben wirken Väterbrauch und
Stammeseigenart, indem sie die Auswahl unter den verschiedenen
wirtschaftlich möglichen Siedelungs- und Gehöftformen bestimmen. So
werden diese Formen zum Ausdruck der besonderen Art des siedelnden
Volkstums, und in der Entwicklung von Dorf und Haus erblicken wir
wie in einem Spiegel die Geschichte des Volks, das sie schuf.
I. Aus der Siedlungs- und Wirtschaftsgeschichte
Lauenburgs.
Für die Siedelungsgeschichte des Herzogtums
Lauenburg ist die Tatsache grundlegend, daß die germanischen Stämme,
die seit den ältesten, überhaupt geschichtlicher Forschung
zugänglichen Zeiten im Lande gesessen hatten, in der Zeit der
sogenannten großen Völkerwanderung aus dem Lande verschwanden und
dem von Osten her sich vorschiebenden slavischen Volkstum Platz
machten. So kam es, daß mindestens 400 Jahre - von
spätestens 800 bis 1200 nach Christi
Geburt - das lauenburgische Land so gut wie ganz östlich jener Linie
lag, die Deutschtum und Slaventum schied, bis um 1200
die ostwärts zurückschlagende Welle deutschen Volkstums auch das
Gebiet des heutigen Kreises Herzogtum Lauenburg der deutschen Kultur
wieder gewann. So zerfällt die Volkstumsgeschichte unseres Gebietes
von selbst in drei Zeiträume, einen germanischen bis etwa 500
oder 800 nach Christi Geburt, einen slavischen bis
1200 und einen deutschen, dessen Dauer für die Zukunft
durch Verankerung unseres Volkstums im Heimatboden zu sichern die
Aufgabe der deutschen Gegenwart ist.
Welche Spuren haben diese Wandlungen des Volkstums in den Formen von
Dorf und Haus hinterlassen? Um die richtige Deutung dieser Formen zu
finden, werden wir die nach Osten und nach Westen angrenzenden
Gebiete zum Vergleich heranziehen müsssen und uns die äußeren
Schicksale des späteren Herzogtums Lauenburg zu vergegenwärtigen
haben.
Wann die germanische Zeit, die unsere Hünengräber getürmt hat, zu
Ende gegangen ist, das ist kaum genau zu bestimmen. Wir wissen nur,
daß anscheinend schon um das Jahr 160 nach Christi
Geburt die Hauptmasse der Langobarden, des zuletzt im
Lauenburgischen nachweisbaren germanischen Volkes, nach Süden
abzieht, um endlich nach heldenhaften Taten im heutigen Volkstum
Norditaliens aufzugehen. wo der Name der "Lombardei" heute noch von
den germanischen Einwanderern zeugt. Westlich der Elbe sind Reste
langobardischen Volkstums im Bardengau um Bardowiek sitzen
geblieben.Ob auch
1927/1 - 2
1927/1 - 3
im Lauenburgischen? Die Vorkämpfer der sogen.
Urgermanentheorie haben für das gesamte ostelbische Deutschland die
ununterbrochene Fortdauer germanischen Volkstums auch währeud der slavischen
Jahrhunderte behauptet. Nur habe sich eine dünne wendische Herrenschicht
darübergelegt. Ohne diese vorwiegend germanische Unterschicht sei der schnelle
Sieg deutscher Sptache und Kultur um 1200 ganz unerklärlich, meint
man. Aber darüber kann man verschiedener Meinung sein. Und irgendwelche wirklich
greifbaren Tatsachen lassen sich für diese "Urgermanentheorie" nicht beibringen.
Die gründliche Slavisierung unserer alten Ortsnamen spricht sogar entschieden
gegen ein Überdauern nennenswerter germanischer Volksreste. Man muß einmal
unsere Dorfnamen nachprüfen, - nicht wie sie heute lauten, sondern in der alten
Form, die uns das berühmte Zehntenregister des Bistums Ratzeburg aus der Zelt
um 1230 erhalten hat. Da heißt Holstendorf noch Slavicum
Pogatse" Wendisch-Pogeez. Ein
scheinbar so deutscher Name wie Schlagbrügge erseheint als Slaubrize,
Poggensee
hat seinen Namen nicht von einem See mit Poggen, sondern durch deutsche
Umdeutung des gut slavischen Pokense erhalten. Walksfelde heißt zwar schon
1230
Walegotesvelde, aber noch 1158 durchaus slavisch Walegotsa, und in derselben
Urkunde von 1158 - es handelt sich um die Ausstattung des neuen Bistums
Ratzeburg- wird ein slavisches Kolatza genannt, das schon 1174
Clotesvelde und heute
Horst (bei Schmilau) heißt. Nach diesem Befund erscheint es als höchstwahrscheinlich, daß nennenswerte langobardische Volksreste nördlich der Elbe
überhaupt nicht zurückgeblieben und die etwa vorhandenen rasch slavisiert waren.
Ums Jahr 800, als die freilich nicht im Sturm heranbrandende, sondern
unmerklich leise höher steigende Slavenflut ihren höchsten Stand erreichte,
verlief die Vorpostenlinie des Deutschtums etwa an der Westgrenze des Kreises,
der selber jedenfalls zum weitaus größten Teile dem Siedlungsgebiet der Polaben,
eines Stammes der wendischen Obotriten, angehörte. Genau abgesteckt worden ist
die deutsch-wendische Herrschaftsgrenze anscheinend in den letzten Lebensjahren
Karls des Großen. Nach der Beschreibung durch den Domherrn Adam von Bremen im
11. Jahrhundert verlief dieser Grenzzug, Limes Saxoniae oder
Saxonicus d. h.
"Sachsenmark" genannt, von der alten Ertheneburg bei Schnakenbeek nordwärts nach
Krüzen, die Au hinab bis zur Einmündung in die Linau bei Lütau, diesen Bach
hinab bis zur Delvenau, dann die Delvenau aufwärts bis zur Einmündung der
Hornbek, diese hinauf, dann über Talkau, zwischen Gr. und Kl. Schretstaken durch
zum Sirksfelder Wallberg, auch Koberger Wall genannt, von da in einer nicht
genauer feststellbaren Linie, vielleicht an der Barnitz entlang zur Süderbeste
und an dieser abwärts bis zu ihrer Einmündung in die Trave bei Oldesloe. Von da
ging die Linie die Trave aufwärts bis nördlich an Segeberg, über Bornhöved nach
Preetz ins Gebiet der Schwentine und diese abwärts bis zur Kieler Förde. Dies kann
aber lediglich politische Grenze, nicht Sprach- und Siedelungsgrenze gewesen
sein, denn die slavischen Ortsnamen herrschen noch viel weiter nach Westen bis
an den Sachsenwald.
1927/1 - 3
1927/1 - 4
Dahmker, Kasseburg, Sahms, Grabau, Pampau, Rülau
- bei letzteren mit der gleichen bezeichnend slavischen Endung wie in Gülzow,
Kollow usw. Im schon erwähnten Ratzeburger Zehntenregister von 1230
sind die Endungen -au und -ow noch ganz gleichmäßig: Pampowe,
Grabowe, Lutowe, Basdowe, Colodowe
(Kollow), Putrowe (Pötrau). Zu allem Überfluß aber
bezeichnet das Register ganz ausdrücklich die Bewohner folgender westlich oben
beschriebener Grenze gelegenen Dörfer als selbst noch um 1230
slavisch: Wankelowe (Wangelau), Elmhorst,
Grabowe, Grove, Slavicum Pampowe (Kl.
Pampau), Lelecowe und Cemerstorp - letztere beiden
heute nicht mehr feststellbar, aber alle sieben im Kirchspiel Siebeneichen
gelegen. Außer diesen Dörfern sind im Lauenburgischen, aber östlich der oben
bezeichneten Grenzlinie, noch Sciphorst, Slavicum Parketin
(Kl. Berkenthin) und Slavicum Pogatse (Holstendorf) als
Wendendörfer und folgerichtig ohne Angabe von Hufenzahl und Zehntleistung
aufgeführt. Der ganze Südwesten des heutigen Kreises Herzogtum Lauenburg, alles
Land südlich der Linie Kuddewörde-Grambek und westlich der Delvenau, gehörte
nicht zum politischen Herrschaftsgebiet des Stammes der Polaben, sondern zur
Mark Sadelbandia, und diese gehörte zum alten Herzogtum Sachsen, das von
Dortmund bis Kiel reichte und von 1142 bis 1180 in
Heirich dem Löwen seinen letzten und größten Herzog hatte. Ob der Name
"Sadelbandia" deutsch oder slavisch ist, läßt sich nicht bestimmt entscheiden,
auf jeden Fall aber war ums Jahr 1150 nur eine wenig zahlreiche
Bevölkerung slavischen, wahrscheinlich polabischen Stammes im Lande. Trotz der
politischen Herrscherstellung des Sachsenherzogs ist damals sicherlich noch
keine irgendwie nennenswerte Zahl deutscher, niedersächsischer Siedler im Lande
Sadelbandia vorhanden gewesen. Einen sehr großen Teil dieses Gebietes nahm der
alte Grenzwald ein, von dem heute in Sachsenwald und Hahnheide noch stattliche
Reste vorhanden sind, der aber zu jener Zeit wahrscheinlich noch in
geschlossenem Bestande bis weit über die heutige Straße Bergedorf-Schwarzenbek
südwärts gereicht hat.
Was ist nun nach 1230 aus der slavischen Bevölkerung im
Lauenburgischen geworden? Die sogen. Ausrottungstheorie nahm an, daß ein wahrer
Vernichtungskampf gegen das wendische Volk geführt worden sei, bis nichts mehr
übrig blieb. Aber für diesen Vernichtungskampf gibt es keinerlei Beweise, und
schon der verstorbene Prof. Hellwig-Ratztburg hat der "Verflüchtungstheorie" die
Frage entgegengehalten, woran denn eigentlich das Wendenvolk gestorben sein
solle? Etwa am Gram um die verlorene Nationalität? Oder ob die Wenden sich etwa
dem Genusse des Feuerwasser ergeben hätten, wie die Indianer in Nordamerika?
Auch von einer Auswanderung der Wenden wissen wir nichts. Die ganze Ausrottungs-
oder Verflüchtigungstheorie beruht auf einem Mißverständnis unserer Urkunden,
vorab des vielgenannten Zehntenregisters. Man hat gemeint: Da die Wenden keine
Einteilung der Feldmark in Hufen kannten und den kirchlichen Zehnten nicht zu
zahlen brauchten, so muß jedes Dorf, dessen Feldmark in Hufen liegt und dessen
Bauern den Zehnten zahlen, von deutschen Kolonisten besiedelt sein. Nach den
Urkunden,
1927/1 - 4
1927/1 - 5
insbesondere nach ausdrücklicher Angabe des
Zehntregisters, zahlten die Slaven statt des Zehnten drei wendische Scheffel
(Kuriz) Weizen, einen Topp Flachs, ein Huhn und einen Schilling vom Haken. Etwa
60 Jahre früher schrieb der Priester Helmold zu Bosau am Plöner
See in seine Slavenchronik: "Der Herzog (Heinrich der Löwe) schrieb den Slaven,
welche im Lande der Wagiren (Wagrien d. h Ostholstein), der Polaben, der
Obotriten und der Kicinen (bei Rostock) übriggeblieben waren, dieselben Steuern
an das Bistum vor, welche bei den Polen und (slavischen) Pommern erlegt werden,
d. h. von jedem Pfluge drei Scheffel Weizen und 12 Stück gangbarer
Münzen. Der Scheffel aber hieß bei den Slaven Curitce, und ein slavischer Pflug
wird zu zwei Ochsen und ebensoviel Pferden gerechnet." Es handelt sich also bei
den Slaven um eine Besteuerung der Gespannhaltung, dagegen beim Zehnten um einen
stimmten Ernteanteil. Für den Bischof brachte der Zehnte bedeutend mehr als die
wendische "Biskopnitza". Und der Graf von Ratzeburg bezog vom Kirchenzehnten der
meisten Dörfer auf Grund lehnsrechtlicher Übertragung die Hälfte für sich. Graf
und Bischof waren daher auf das Stärkste daran interessiert, daß ein Dorf
"deutsch" wurde statt "wendisch", d. h. daß es den Kirchenzehnten zahlte statt
der Biskopnitza. Oft hören wir daher, daß die Wenden eines Dorfes im Rechtswege
durch Kündigung ausgewiesen oder auf den kleineren Teil der Feldmark beschränkt
werden. So wird noch ums Jahr 1250 Wendisch-Pogez geräumt, mit
holsteinischen Siedlern besetzt und Holstendorf genannt. So muß es auch gekommen
sein, wenn neben einem deutschen Dorf ein gleichnamiges Wendendorf steht wie
Slavicum Karlowe (neben Karlow), Slavicum Turowe (Kl.
Thurow), Slavicum Sethorp (neben Seedorf), Slavicum Sakkeran
(neben Segrahn), Slavicum Sirikesvelde (neben Sirksfelde),
Slavicum Sarowe (Kl. Sarau). Nun leisten aber alle diese als
wendisch aufgeführten Dörfer den Zehnten. Sind etwa auch von hier später die
Wenden vertrieben worden? Aber wohin dann? Und waren in dieser Zeit gewaltigsten
Bedarfes an deutschen Arbeitskräften für das ganze weite ostelbische Land auch
genügend deutsche Bauernsöhne jederzeit aufzutreiben? Da ist es doch wohl die
nächstliegende Lösung, daß man eben die Wenden zu Deutschen gemacht und sie
dadurch zur Zehntleistung verpflichtet hat, indem man ihnen das deutsche Recht
verlieh. So scheint es z. B. in Lütau gegangen zu sein. "Im Dörfe Lütau", sagt
das Zehntregister, "hat der Graf Reinold den Zehnten besessen, der die Äcker des
Dorfes in der Art und Weise eines Lehens zehntbar gemacht hat. Anscheinend ist
also hier deutsches Recht auf die slavischen Bewohner übertragen worden,
ähnlich, wie es 1220 mit den Wenden in Brüsewitz bei Schwerin
urkundlich geschehen ist. Man darf ruhig annehmen, daß die Aufnahme von Wenden
ins deutsche Recht keineswegs selten gewesen ist. Woher stammt denn sonst die
große Zahl slavischer Namen, die Witte in "deutschen" Dörfern Mecklenburgs
nachgewiesen hat? Man versteht unsere Urkunden, vor allem wiederum das
Zehntregister, gründlich falsch, wenn man sie als eine Art
Nationalitätenkataster liest. Den Ausstellern und Empfängern der Urkunden war
die Herkunft der Kolo-
1927/1 - 5
1927/1 - 6
nisten - von deutschen oder wendischen Eltern -
gleichgültig, ihnen kam es auf die Rechts- und Wirtschaftsverhältnisse an. Wenn
ein Wende es übernahm, Zins und Zehnten zu entrichten wie die deutschen
Einwanderer, - warum sollte man ihm deutsches Recht verweigern? Bei den oben
erwähnten sieben Dörfern des Kirchspiels Siebeneichen in der alten Sachsenmark
Sadelbande, die das Zehntenregister ausdrücklich als "slavische Dörfer"
bezeichnet, werden in der Tat Hufen nach deutscher Art aufgeführt, aber der alte
slavische Charakter dieser Gegend kommt noch darin zu deutlichem Ausdruck, daß
in Sadelbande nicht der volle Zehnte gegeben wird, sondern "nach einer sehr
schlechten Gewohnheit", wie der geistliche Verfasser unzufrieden bemerkt, nur
vier Scheffel Weizen von der Hufe. Das muß auf die alte Biskopnitza zurückgehen.
Man merkt deutlich, wie sich hier der Übergang der slavischen Bewohner der
Landschaft Sadelbande, d. h. also des ganzen Gebietes zwischen Elbe, Bille,
Hornbek und Delvenau, aus wendischen in deutsche Rechtsverhältnisse vollzieht.
Worin nun freilich die Vorteile deutschen Rechtes gegenüber der höheren
Belastung bestanden, können wir nur ungefähr sagen. Jedenfalls war der Inhaber
deutschen Rechtes nicht hörig, sondern freien Standes. Ob aber, wie man wohl
behauptet hat. zum deutschen Rechte das erbliche Nutzungsrecht am Grund und
Boden gehört habe, ist ungewiß. Wahrscheinlich hatte nur ein Teil der deutschen
Einwanderer verbrieftes Erbrecht an seiner Scholle. Die Regel bildete das
Erbrecht nur da, wo der Grund und Boden erst vom Urwald geklärt oder entsumpft
werden mußte, wie es etwa in dem breiten waldbedeckten Küstenstreifen von Lübeck
bis Greifswald und Wolgast der Fall war. Das ist das Hauptgebiet der sogen.
Hagendörfer oder Waldhufendörfer. Wo aber der Boden schon in der Wendenzeit
urbar gewesen war, ist erbliches Nutzungsrecht bei den deutschen Kolonisten die
Ausnahme gewesen. Freies, aber kündbares Pachtrecht war die Regel. Eine Gefahr
für ihre oder ihrer Kinder Stellung haben die deutschen Kolonisten im Mangel der
rechtlich verbrieften Erblichkeit nicht erblickt, da es für die Grundherrschaft
geistlicher wie weltlicher Art kaum eine andere Nutzungsweise als durch
bäuerliche Erb- und Zeitpächter gab. Denn den landwirtschaftlichen Großbetrieb
hat, abgesehen von ein paar Gutswirtschaften der Mönchsklöster, erst die Neuzeit
verbreitet. Der einzige nachweisbare Fall von Bauernlegung schon im Mittelalter
in unserer Gegend geht denn auch von geistlicher Seite aus. Es handelt sich um
die Verwandlung des Dorfes Rodemuszle (Römnitz gegenüber der Stadt
Ratzeburg) in einen Gutsbetrieb des Domkapitels zu Michaelis 1285.
Dazu wurde den Bauern ein Jahr und vierzehn Wochen vorher gekündigt, beim Abzug
der Wert der Häuser und der Meliorationen durch von beiden Seiten ernannte
Taxatoren abgeschätzt und der Schätzungswert den abziehenden Pächtern
ausgezahlt. Die Bauern, deren Namen rein deutsch ohne allen wendischen
Beigeschmack lauten, konnten also hier von bei Grundherrschaft in aller Form
Rechtens gekündigt werden. Hörig waren sie nicht. Solche freien bäuerlichen
Pächter nennt der "Sachsenspiegel", das berühmte niedersächsische Rechtsbuch, um
1230 "Landseten", Landsassen. Aber solche Kündigung war eben
seltene Aus-
1927/1 - 6
1927/1 - 7
nahme, denn der Ritter des Mittelalters war kein
Landwirt, sondern Soldat, Verwaltungsmann und Grundrentenbezieher, wie es heute
noch der westdeutsche Adel größtenteils ist. Die zahlreichen Pachtbauern des
westfälischen oder ostfriesischen Adels sitzen seit langen Geschlechterfolgen
auf ihren Stellen. Auch für Ostholstein ist Ansiedelung mit tatsächlicher, aber
nicht rechtlich erzwingbarer Erblichkeit der Hufen im Mittelalter die Regel
gewesen. "Die Ansiedler mögen auf die ausdrückliche Versicherung der Erblichkeit
kein besonderes Gewicht gelegt haben, denn daß man sie und ihre Nachkommen auf
den Stellen ließ, solange sie ihre Heuer bezahlten, lag im Interesse des Herrn
selbst", schreibt Max Sering in seinem großen Werke über Erbrecht und
Agrarverfassung in Schleswig-Holstein mit Bezugnahme auf das ehemals slavische
Ostholstein.
Ein anderes Gesicht bekam aber diese Rechtslage, als mit dem Niedergang des
Rittertumes der ostelbische Ritter zum eigenen Betrieb der Landwirtschaft im
Großen überging. Da ist ein großer Teil der Bauernhufen vom Grundherrn
eingezogen und zu adeligen Großgütern zusammengeschlagen worden, zumal als im
sechzehnten Jahrhundert die Getreide-, Fleisch- und Wollpreise auf das Doppelte und
Dreifache emporschnellten und zur Eigenwirtschaft lockten. Zur Bewirtschaftung des
umfangreichen Hoffeldes, das so aus den Feldmarken niedergelegter, d. h. dem
"Bauernlegen" zum Opfer gefallener Dörfer zusammenwuchs, dienten die Hand-
und
Spanndienste der verschont gebliebenen Bauern. Zu einer Leibeigenschaft wie in
Ostholstein ist es aber im Lauenburgischen nicht gekommen. Dazu war der Einfluß
der seit 1689 regierenden hannöverschen Landesherrschaft dem Adel gegenüber zu
stark. Dem Einfluß Hannovers war es auch zuzuschreiben, daß das alte Zinsverhältnis
der Bauern durch das erbliche Meierrecht, wie es im Lüneburgischen herrschte,
verdrängt wurde. Nur auf den adeligen Gütern Wotersen, Lanken und Seedorf
genossen die Bauern kein Erbrecht. Die Hofdienste betrugen im Durchschnitt für den
Vollhufner wöchentlich zwei Tage Spanndienst und zwei Tage Handdienst, für
Teilhufen weniger. Die Kätner leisteten Handdienste, oft nur einen Tag in der
Woche. Die Hofdienste waren jedoch für die einzelnen Güter verschieden, aber
nach dem Herkommen unabänderlich bestimmt. Im Zeitalter des absoluten
Fürstentums, dessen glänzendste Vertreter die preußischen Könige Friedrich Wilhelm
I.
und Friedrich der Große waren, wurde wie in Preußen so auch im Kurfürstentum
Hannover eine allgemeine Reform der bäuerlichen Verhältnisse in Angriff genommen,
die darauf hinauslief, den Bauern wirtschaftliche und rechtliche
Ellbogenfreiheit zu schaffen. Dazu gehörten die sogen. Verkoppelung und
Gemeinheitsteilung, über die noch zu sprechen sein wird, sodann die Ablösung
aller Hofdienste gegen billige Entschädigung (Dienstgeld), gleichmäßige Festsetzung
der Dömanialgefälle usw. Erhalten blieben nur die sogen. Burgfestedienste für
öffentliche Zwecke, bis 1869 auch ihre Ablösung gegen eine entsprechende
Geldabgabe erfolgte. Schließlich ist am 14. August 1872 durch
preußisches Gesetz
das alte Meier- und Erbzinsrecht in Eigentum übergeführt und durch ein
weiteres Gesetz vom 21. Februar 1881 betreffend das Höferecht
1927/1 - 7
1927/1 - 8
im Herzogtum Lauenburg die Rechtsgrundlage
geschaffen, um die Bauernstellen auch für die Zukunft im Besitze der alten
Bauernfamilien zu erhalten. Wirkt doch nichts verheerender für ein Volk, als
wenn der Grund und Boden, diese Grundlage des gesamten Volkslebens, zur
Handelsware und seinen Besitzern nicht mehr als das kostbare Erbteil der Väter
erscheint, das zu pflegen und kommenden Geschlechtern zu erhalten heilige
Pflicht ist, sondern nur noch unter dem Gesichtspunkt des höchsten erzielbaren
Verkaufspreises betrachtet wird.
II. Die lauenburgischen Dörfer.
Es ist seit langer Zeit aufgefallen, daß die
Anlage der Dörfer in den verschiedenen Gebieten Norddeutschlands
beträchtliche Unterschiede ausweist, die sich nicht durch die
Verschiedenartigkeit der örtlichen Lage und der Bodenverhältnisse
erklären lassen. Man hat daher die Gründe der Entstehung unserer
Dorfformen großenteils in geschichtlichen und völkischen
Verhältnissen suchen müssen. Eine besonders auffallende Form der
Dorfanlage und daher wohl auch diejenige, die zuerst die
Aufmerksamkeit der Geschichtsforscher in besonderem Maße auf sich
zog, sind die sogenannten Rundlinge. Wir haben sie im
Lauenburgischen nicht selten, wenn sie auch namentlich seit der
Verkoppelung durch Verlegung der Hofstellen vielfach verändert und
daher auf den heutigen Meßtischblättern schwerer zu erkennen sind
als auf den alten Flurkarten des 18. Jahrhunderts.
Diese sind daher auch die Grundlage der beigefügten
Kartenzeichnungen. Brunstorf Abb. 1) ist als besonders
großes und schönes Beispiel der Rundlingsgruppe gewählt worden.
Diese ist gerade in der alten Landschaft Sadelbande zahlreich
vertreten. Havekost, Möhnsen, Kasseburg, Hohenhorn, Dassendorf,
Talkau, Koberg sind alte Rundlinge. Bezeichnend für diese Dorfform
ist die hufeisenförmige Anordnung der alten Bauernhöfe um einen
geräumigen Dorfplatz, der nicht gerade kreisrund zu sein braucht,
aber doch etwa ebenso breit wie lang ist. Oft enthält er den
Dorfteich, nicht selten auch die Kirche. Alle Gehöfte kehren dem
Dorfplatz ihre Einfahrt zu. Dieselbe Art der Dorfanlage ist im
westlichen Mecklenburg, so auch im Lande Boitin, dem Kerne des
Bistums und späteren Fürstentums Ratzeburg um Schönberg sehr
verbreitet, kommt aber weiter westlich des Kreises Herzogtum
Lauenburg, z. B. schon im mittleren und westlichen Holstein so gut
wie gar nicht vor. Die Verbreitung des Rundlings reicht also
ziemlich genau so weit nach Westen wie die Verbreitung der
wendischen Ortsnamen. Das bewährt sich auch weiter südlich im
Hannöverschen, wo die Rundlings- und Wendengrenze zusammen die
Ilmenau aufwärts an Lüneburg vorbei, dann die Ise abwärts bis nach
Gifhorn und schließlich längs der Ohre zur Elbe unterhalb Magdeburgs
verlaufen. Diese Beobachtung schien den schlüssigen Beweis zu
liefern, daß der Rundling von den Wenden ausgebildet sein müsse.
Allerdings mußte es gegen diese Annalune Bedenken erwecken, daß im
ganzen eigentlichen altslavischen Siedelungsraum zwischen Oder und
Ural der Rundling fehlt. Seine Verbreitung erstrebt sich somit über
lauter Gebiete, die bis zur Völkerwanderung germanisch gewesen und
erst seit dem 5. oder
1927/1 - 8
[Nicht paginierer
Einschub: Beidseitig bedruckte große Abbildungen:]
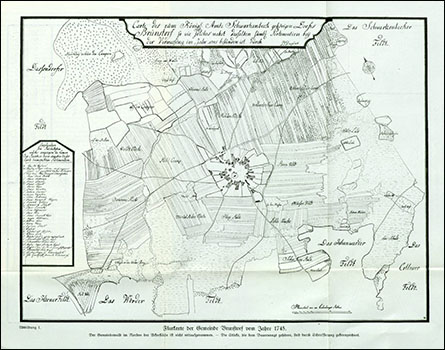
Abbildung 1.
Flurkarte der Gemeinde Brunstorf
vom Jahre 1745.
Der Gemeindewald im Norden der Ackerfläche ist nicht mitaufgenommen.
-
Die Stücke, die dem Bauernvoigt gehören, sind durch Schraffierung
gekennzeichnet.

Abbildung 2.
Flurkarte der Gemeinde Fuhlenhagen
vom Jahre 1748.
Die Stücke, die dem Bauernvoigt gehören, sind durch Schraffierung
gekennzeichnet.
1927/1 - 9
6. Jahrhundert nach Christi Geburt
von den Slaven besetzt worden sind. Man hat daher vermutet, daß der Rundling
nicht eigentlich eine Lieblingsform slavischer Niederlassung sei, sondern in dem
Grenzgebiete, wo sich deutsche oder germanische Siedler mit Slaven stießen und
drängten, sich die Rundform bei beiden Parteien besonderer Beliebthrit erfreut
habe, weil sie sich vor allen Dorfformen durch ihre Verteidigungsfähigkeit
auszeichne. Daran ist allerdings soviel richtig. daß die gegenseitige schnelle
Nachbarhilfe bei der Siedelung in Rundlingsform besser gewährleistet ist als bei
irgend einer anderen, weiter auseinandergezogenen Form der Niederlassung. An
eine Verteidigung gegen regelrechte kriegerische Unternehmungen darf man dabei
freilich nicht denken. Es ist mit Recht darauf aufmerksam gemacht worden, daß
die Kräfte der Bewohner eines solchen Runddorfes auf keinen Fall dazu
ausreichten, um einen etwa rund um das Dorf gezogenen Wall oder Palisadenzaun
genügend zu besetzten und ernstlich zu verleidigen. Außerdem würde, da ja der
Dorfplatz zur Aufnahme des Viehes diente, das Hineinschießen etlicher brennender
Pfeile in einem solchen Kraal voll zusammengepferchten Viehes genügt haben, um
unter letzterem eine solche Panik zu erzeugen, daß jede Verteidigung unmöglich
gewesen wäre. Nun kommen aber auch Rundlinge in unbestritten germanischen
Gegenden wle Südschweden und namentlich Ostfriesland vor, wo der völlig rein
ausgebildete Rundling geradezu die allgemein übliche Siedlungsform der ältesten
Zeit ist. Nördlich Emden auf der Halbinsel Krummhörn findet man noch heute über
dreißig untadelige Rundlinge, in den übrigen ostfriesischen Marschen ist diese
Dorfform erst in jüngerer Zeit meist der Einzelhofsiedelung gewichen. Auch im
westdeutschen Binnenlande, wo das scheinbar völlig regellose Haufendorf
herrscht, fanden sich bei näherem Zusehen Dörfer. die aus alten Rundlingen oder
"Platzdörfern" dadurch hervorgegangen waren, daß der Dorfplatz in Hausplätze
aufgeteilt und zugebaut worden war. Somit scheint der Rundling den Germanen ganz
allgemein nicht fremd gewesen zu sein, sich aber nur in gewissen Außenbezirken
gehalten zu haben, während er im Kernland durch das regellose Haufendorf
verdrängt wurde. Warum behauptete der Rundling sich nicht im germanischen
Kernlande zwischen Elbe, Rhein und deutschem Mittelgebirge? Das Haufendorf ist
volkreicher als der Rundling, der nur für eine begrenzte Zahl von Hofstellen
Raum bietet. Mehr Volk auf derselben Feldmark setzt aber eine höhere Stufe der
Landwirtschaft voraus, da ja Einfuhr von Getreide aus der Ferne für die ältere
Zeit nicht in Betracht kommt. Nun wissen wir, daß bei den Germanen der Zeit um
Christi Geburt der Ackerbau zwar durchaus geläufig, jedoch für die
Volksernährung von geringerer Bedeutung war als die Viehzucht. Da die Düngung
den Germanen noch nicht bekannt gewesen zu sein scheint, mußte man das Land
jahrelang in Dreesch liegen lassen und beweiden, bevor man wieder Getreide darin
säete. Das germanische Vieh wird von römischer Seite als klein und unansehnlich
geschildert, es mag wohl auch wenig Milch gegeben haben, da von rationeller
Fütterung keine Rede sein konnte. Die Kühe ernährten sich auf der Weide und
kannten ursprünglich kein Dach über
1927/1 - 9
1927/1 - 10
dem Kopfe, selbst im Winter. Wir werden bei der
Erörterung des Bauernhauses erkennen, daß die "Kübbungen", die als Ställe
dienen- hier zu Lande sagt man "Assiden" - eine nachträgliche Errungenschaft des
niedersächsischen Hausbaues sind. Ursprünglich blieb also der Stolz und Reichtum
des germanischen Hofbesitzers, sein Viehstapel, Tag und Nacht, Sommer und Winter
unter freiem Himmel - bei gutem Wetter tagsüber unter der Aufsicht des
Gemeindehirten mit der gesamten Herde der Dorfgenossen zusammen auf der
gemeinsamen Weide der Markgenossenschaft, bei schlechtem Wetter und des Nachts
auf dem Dorfanger, wo der Dorfteich als Viehtränke diente. Dieser Dorfanger ist
das eigentliche Kernstück des Rundlings, auf ihm war das Vieh gesichert gegen
Verlaufen und Viehdiebstahl. Eben daher kommt es auch, daß die meisten Rundlinge
bis in die neueste Zeit hinein nur einen einzigen Zufahrtsweg besaßen,
gewissermaßen den erweiterten Kopf einer Sackgasse bildeten und daß an dieser
einzigen Zu- und Ausfahrt gerne die Kate des Gemeindehirten lag. Der Rundling
war also eine Dorfform, die einem Landwirtschaftsbetrieb mit stark vorwiegender
Viehwirtschaft ohne Stallfütterung und ohne staatlichen und polizeilichen Schutz
gegen Viehdiebstahl angemessen war. Für ausgedehntere Ackerwirtschaft dagegen
ist eine Dorfform mit einem einzigen Ein- und Ausfahrtsweg, wo sich in der
Bestellungszeit alle Aekergespanne und in der Erntezeit alle vollen und leeren
Erntewagen der ganzen Dorfschaft beständig kreuzen und einander behindern
müssen, im höchsten Grade unbequem und unzweckmäßig. Mit einem modernen Ausdruck
könnte man also sagen: Der Rundling entsprach sehr extensiver Wirtschaftsweise.
Also verschwand er auch, wo die Wirtschaft intensiver wurde, der Ackerbau
vordrang und im Zusammenhang damit die Bevölkerung zunahm. Der Rundling
behauptete sich, wo die Klimaverhältnisse den Vorrang der Viehwirtschaft mit
Weidegang dauernd aufrecht erhielten, wie in den Nordseemarschen, oder wo die
Bevölkerung lange dünn blieb, wie in den Landen, die vom 5. bis
zum 12. Jahrhundert wendisch geworden waren, und wo die
Wirtschaftsweise seit der Germanenzeit wohl eher noch einen Rückschritt gemacht
hatte. In diesem Sinne kann man dann also wohl auch den Rundling mit den Wenden
in Verbindung bringen, daß sie seinen Vorgänger, das Platzdorf, von ihren
germanischen Vorgängern übernahmen, und die Rundlingsform vielleicht sogar erst
recht regelmäßig ausbildeten, eben weil sie auf der Stufe extensiver
Viehwirtschaft stehen blieben. Daß die Rundlinge so oft slavische Namen haben,
obwohl sie wahrscheinlich zum großen Teile uralte Platzdörfer germanischer
Herkunft sind, geht auf die Tatsache zurück, daß die Slaven das ostelbische Land
wohl fast menschenleer vorgefunden haben.
Daß die seit dem 12. Jahrhundert ins Land kommenden deutschen
Kolonisten nicht sofort die intensiven Wirtschaftsformen des westelbischen
Mutterlandes ins Wendenland verpflanzen konnten, ist leicht einzusehen, wenn man
die Frage aufwirft, wo denn damals der Bauer östlich der Elbe überschüssiges
Korn zu Markte bringen sollte? Es ist allgemein koloniale Art, die
Erzeugungskräfte des Bodens nicht sofort auf das äußerste anzuspannen. Erzeugt
doch selbst heute noch der
1927/1 - 10
1927/1 - 11
amerikanische Farmer nur halb soviel an Getreide
vom Hektar Ackerland wie der deutsche Landwirt auf seinen durchschnittlich
geringeren und mehrere Jahrtausende länger zum Ackerbau herangezogenen Böden.
Daß auch die deutschen Kolonisten noch Rundlinge angelegt haben, ist daher nicht
zu verwundern. Für Mecklenburg ist die Anlage deutscher Kolonistendörfer in
Rundlingsform "von wilder Wurzel", d. h. auf bisher unberührtem Urwaldboden, uns
sicher bezeugt. Nördlich der Bahnlinie Güstrow-Teterow erscheinen auf alten
Karten drei Rundlinge namens Zierhagen, Warnkenhagen und Wattmannshagen. Heute
sind sie längst durch das Bauernlegen zu Gütern gemacht und ihre Dorfform
unkenntlich geworden. Daß es aber deutsche Neugründungen sind, zeigt die
Namensendung "hagen". Für Lauenburg liegt es nahe, etwa gerade Brunstorf für
eine deutsche Neugründang zu halten, da das Dorf im Zehntenregister von
1230 noch nicht genannt wird, wohl aber 1299, - da es
ferner den Namen eines deutschen Gründungsunternehmers enthalten könnte und da
es endlich für einen Rundling außerordentlich umfangreich angelegt ist, indem
Rundlinge alter Art mit slavischen Ramen nicht über 8
Bauernstellen zu enthalten pflegen. Nicht ohne Bedeutung für diese Frage wäre es
festzustellen, wo der Name Hamester bis in die Siedelungszeit zurückgeht. Auf
den alten Flurkarten von Hohenhorn und Brunstorf - letztere ist dieser Arbeit
beigefügt - aus den Jahren 1745 und 1746 fehlt in
der Liste der Grundbesitzer der sonst so weit verbreitete Familienname
Burmeister. Dieser Name ist ursprünglich die Amtsbezeichnung für den
Gemeindevorsteher oder, wie man im 18. Jahrhundert sagte, den
Bauervogt. Dagegen findet sich in Brunstorf 1745 ein Hufner Hans
Hofemeister, in Hohenhorn ein Claus Hovemeister. Der letztere ist jedenfalls
dieselbe Person, die im Kornregister von 1725 als Claus Hahmester
in Hohenhorn anfgeführt, vom nächsten Jahre ab aber als "Hoffemeister"
weitergeführt ist. Auch in Kröppelshagen, dessen Name ja schon das alte
Hagendorf, die Rodung deutscher Kolonisten verrät, kennt das Kornregister von
1725 einen Carsten Hahmester.
Weiter erscheinen im Kornregister von 1761 in dem deutschbenannten echten
Rundling Dassendorf zwei Bauern und in Brunstorf noch ein Bauer namens
"Hoffemeister", die alle drei beim Jahre 1762 als "Hamester"
wiederkehren. Daraus
ergibt sich ganz offensichtlich, daß die Schreibung "Hovemeister" und
"Hofemeister" auf den Flurkarten von 1745/46 nichts anderes ist als nach der üblen
Gewohnheit jener Zeit eine falsche Verhochdeutschung von Hamester. Dieser Name
hat mit Hofmeister nichts zu tnn, sondern gehört zu dem in Mecklenburg und
Vorpommern weitverbreiteten Familiennamen Hagemeister. Das aber ist die alte Amtsbezeichnung
des Gemeindevorstehers oder Bauervogtes in den sogen. Hagendörfern, d. h den oben
genannten Dörfern "van wilder Wortelen", wie es im Sachsenspiegel, der berühmten
Aufzeichnung niedersächsischen Rechtes aus dem 13. Jahrhundert heißt. Solche
Dörfer, deren Flur erst durch die deutschen Einwanderer urbar gemacht werden mußte,
liegen dichtgedrängt in dem breiten Urwaldstreifen, der sich in wendischer
Zeit von Lübeck über Grevesmühlen, Doberan und Rostock bis nach Stralsund und
Greifswald hinzog. Die Dörfer, die
1927/1 - 11
1927/1 - 12
hier entstanden, tragen meistens die Endung
"-hagen", d. h. "-wald". Durchweg zeigen sie nicht die Rundform, sondern sind im
Gegensatz zum Rundling an einer langen "Dorfstraße" - wenn man überhaupt von
einer solchen sprechen darf -, manchmal nur an EINER Seite dieser Straße mit oft
recht beträchtlichen Abständen zwischen den einelnen Gehöften zu einer langen
Reihe auseinandergezogen. Der Grund dieser Anlage ist darin zu suchen, daß man
bei solcher Gestalt von Dörfern "aus wilder Wurzel" auf Urwald- oder Sumpfboden
jedem Kolonisten seine Hufe in einem einzigen langen Streifen zuzumessen
pflegte. Dieser lange Landstreifen stieß im rechten Winkel auf die Dorfstraße,
und hier wurde das Gehöft angelegt. Die Entstehungsweise muß man sich wohl so
denken, daß zunächst die Dorfstraße quer durch das für die neue Feldmark
angewiesene Stckk Urwald frei gemacht und an dieser Dorfstraße jedem
Kolonisten seine bestimmte Breite zugemessen wurde, wo er sein erstes primitives
Blockhaus bauen und von wo er sich in den Wald hineinroden konnte, bis er an die
Grenze der Feldmark stieß. In den nordwestdeutschen Moorkolonien, den sogen.
"Fehnen", die allesamt so angelegt sind und noch heute ebenso neu angelegt
werden, nennt man das Recht des Kolonisten, in der Breite seines Kolonates bis
an die Grenze der Feldmark mit der Abtorfung und Kultivierung vorzurücken, das
"Aufstreckungsrecht". Dieses Verfahren scheint im Lauenburgischen im Gegensatz
zu Mecklenburg bei Walddörfern nicht üblich gewesen zu sein; weder die
Sachsenwalddörfer, noch etwa das Hagendorf Fuhlenhagen (Abb. 2)
zeigt die gewöhnliche Flur - und Dorfgestalt der Waldhufendörfer. Dagegen haben
wir in ganz unmittelbarer Nähe die genau entsprechenden Dorfanlagen auf Boden,
der zwar nicht dem Urwald, wohl aber dem Wasser erst von den deutschen
Kolonisten abgerungen werden mußte, in den Vierlanden und der ehemals
lauenburgischen Artlenburger Marsch (Abb. 3).
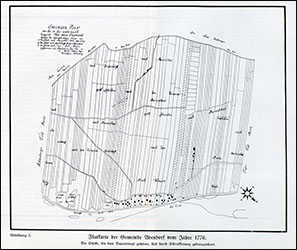
Abbildung 3.
Flurkarte der Gemeinde Avendorf
vom Jahre 1776.
Die Stücke, die dem Bauernvogt gehören, sind durch Schraffierung
gekennzeichnet.
Der Unterschied dieser
sogen. Marschhufendörfer gegen die Waldhufen oder Hagendörfer besteht nur darin,
daß in der gänzlich ebenen und von natürlichen Geländehindernissen freien
Marsch die Abgrenzung der parallel laufenden langen Hufenstreifen mit fast
mathematischer Genauigkeit durchgeführt werden konnte. Als Dorfstraße ergab sich
in dem feuchten Lande ganz von selbst der einzige zu allen Jahreszeiten
begehbare trockene Verbindungsweg in der Marsch: der Deich. Überhaupt ist der
Deich das Rückgrat der Marsch. Bis zur Anlage der Deiche war die ganze
Elbniederung von den Lauenburger Höhen bis nach Bardowiek der Überschwemmung
durch die von der Meeresflut zurückgestauten Wassermassen des Elbstromes zweimal
täglich ausgesetzt. In dem jetzigen Unterlauf der Neetze, der Ilmenau und der
Luhe auf den Strecken, deren Stromrichtung der Hauptrichtung des Elbstromes
entspricht, haben wir nicht eigentlich Nebenflüsse, sondern den früheren
südlichsten Elbarm vor uns. Dieser südlichste Elbarm ist höchstwahrscheinlich
noch im 13. Jahrhundert der Hauptarm des Stromes gewesen. Um etwa
1250 hat aber die Elbe, deren Bett ja damals noch keinerlei
Regelung durch den Menschen erfuhr, eine Stromversetzung weiter nordwärts
vollzogen, so daß ihr Hauptarm nunmehr das Bett der heurigen Ilau mit ihren
oberen Teilen Landwehr-
1927/1 - 12
1927/1 - 13
und Schnedegraben benutzte. Um 1300
muß dann eine weitere noch erheblichere Stromversetzung noch weiter nordwärts
eingetreten sein, so daß nunmehr der Arm mit der stärksten Wasserführung hart
unter dem nördlichen Geestufer daherfloß und die Ortschaften Avendorf und Tespe
vom Nordufer auf das Südufer der Elbe verlegt wurden. Mit dieser Verlegung des
Elbstromes wird auch die Teilung des alten, schon im Zehntenreister als
Kirchdorf aufgeführten Hagede in Geesthacht und Marschacht zusammenhängen.
Hierenach ist es begreiflich, daß bis 1816 der nördliche Teil der
Elbmarschen von der Delvenau bis Geesthacht etwa bis zur Hälfte der Talbreite
lauenburgisch war. Die Kolonisation des Marschlandes war jedenfalls von der lauenburgischen
Seite her in Angriff genommen worden. Diese lauenburgische Siedlungstätigkeit hat
ihre Südgrenze vermutlich in der Ilau und dem sie fortsetzenden Schnedegraben gefunden, denn an dieser endet
heute
noch das Gebiet der gleichmäßigen, langgestreckten und durch rechtwinklig zur
Stromrichtung gezogene, gleichlaufende Gräben abgegrenzten Ackerstücke. Das jetzige Elbbett wird zu Beginn der Siedlung
nur schmal gewesen sein, da seine Wasserführung jedenfalls gering
war, und wird kein Kulturhindernis gebildet haben. Ein Beweis
dafür ist der Umstand, daß bis in die neueste Zeit hinein Bauern
der Lauenburger Geest Besitzteile in der jetzt linkselbischen Marsch und
umgekehrt Marschbewohner Besitzteile auf der nordelbischen Geest
hatten. Dieser Zustand wird jedoch durch Kauf und Austausch immer
mehr beseitigt. Auch die ganz nach demselben System mit Marschhufendörfern
besiedelten Vierlande, die ja heute noch nördlich des
Hauptarmes der Elbe liegen, waren lauenburgisch bis 1420, wo sie von
den Städten Hamburg and Lübeck in gemeinsamer Fehde dem Herzog von Lauenburg abgenommen wurden, um zunächst
"beiderstädtisch", seit 1868 hamburgisch zu werden.
Wer waren nun die Siedler und Deichbauer in den lauenburgischen Marschen? Früher
riet man auf Holländer, die ja im 12. und 13. Jahrhundert bei der Urbarmachung
sumpfiger Niederungen in
ganz Norddeutschland eine wichtige Rolle gespielt haben. Die älteste
Siedelung im Elbtal wird das jetzige Artlenburg sein, das auf einer
flachen sandigen Erhöhung liegt und wo eine der wichtigsten mittelalterlichen Straßen
- der Straßenzug Braunschweig-Gifhorn-Lüneburg-Bardowiek das Elbtal durchschnitt, um sich am
Nordufer der Elbe bei der alten Ertheneburg unweit Schnakenbeck zu gabeln.
Darauf beruhte die Bedeutung und die reiche Geschichte der Ertheneburg. Die eine Straße ging im Zuge der heutigen Bahn nach Lübeck.
Von ihr zweigte eine andere ab, die ins Ostland nach Rostock und
Stralsund führte und die wir durch einen eigentümlichen Rechtszug
kennen, auf den man sich noch im 16. Jahrhundert gegen das pommersche fürstliche Hofgericht zu Wolgast berief. Da ging die Berufung vom
Kirchspielsgericht Pütte bei Stralsund an das Burglehen
in Loitz, vou da an das Buch oder den Stapel in Schwerin, vou da endlich an das
Kirchspiel zu Siebeneichen. Hier muß also das Markding der Grenzmark Sadelbande gehalten
worden sein, und daß die Dingstatt, an der
die dingpflichtigen freien Männer der ganzen Grenz-
1927/1 - 13
1927/1 - 14
mark sich regelmäßig zur Gerichtsversammlung
einzufinden hatten, gerade bei Siebeneichen lag, beweist, daß dieses 1230
genannte Kirchdorf ein wichtiger Straßenkreuzungspunkt war. So war die
Ertheneburg der Schlüssel zum Ostland. Eine Urkunde vom Jahr 1164
erwähnt drei Holländer Hufen nahe der Ertheneburg, die Heinrich der Löwe dem
Lübecker Bischof schenkte. Aber die Bezeichnung "Holländer Hufen" beweist für
das Vorhandensein holländischer Siedler nichts, sondern besagt nur, daß hier
nach holländischem Vorbild kolonisiert wurde. Holländisches Recht war damals
Kolonistenrecht schlechtweg. Die ganzen Marschhufendörfer gehen auf
niederländisches Vorbild zurück, sind aber keineswegs überall von Niederländern
bewohnt gewesen. Alles, was wir über die Eigenart des Volkstums in den
Vierlanden, in der Winsener und Artlenburger Marsch wissen - z. B. über den
volkstümlichen Hausbau - weist auf niedersächsische Ansiedler und nicht auf
niederländische. Wie in den Vierlanden, werden es auch in der lauenburgischen
Elbmarsch Söhne der holsteinischen und lauenburgischen Geest gewesen sein, die
die Marschhufendörfer anlegten, vielleicht unter der Leitung holländischer
Unternehmer und Deichbaumeister, wie sie auch bei anderen schwierigen
Entsumpfungs- und Bedeichungsarbeiten eine Rolle gespielt haben. Begonnen ist
die Bedeichung und Besiedelung der lauenburgischen Elbmarsch wahrscheinlich
unter dem Herzog Heinrich dem Löwen von Sachsen, also zwischen 1139
und 1180, wohin auch die 1164 erwähnten Holländer
Hufen deuten. Die Vermutung, daß die Kolonisten der Elbmarsch damals zu
wesentlichen Teilen aus Dithmarschen gekommen seien, ist auf Grund der
Ortsnamenvergleichung aufgestellt worden durch den Pastor Meyer zu St. Dionys,
doch ist das Beweismaterial kaum ausreichend. Allerdings ist es beachtenswert,
daß in der Zeit des Siedelungsbeginns auf der Ertheneburg jener Graf Reinold aus
Dithmarschen saß, der am 6. Juli 1164 in der
Schlacht bei Verchen am Kummerower See gegen die Slaven fiel und bereits oben
gelegentlich der Zehntbarmachung des Dorfes Lütau erwähnt wurde.
Wie erst deutsche Kolonisten die Elbmarsch dem wilden, ungezügelten Strome
abrangen, so haben auch wohl sicher erst deutsche Kolonisten die Gegend südlich
des Sachsenwaldes durch Zurückdrängung des Urwaldes kulturfähig gemacht. Die
slavisch benannten Dörfer Kollow und Gülzow freilich sind sicher älter, reichen
möglicherweise bis in die germanische Zeit zurück. Dafür spricht ihre klare
Rundlingsform, die vermutlich von Slaven aus der Form des germanischen
Platzdorfes weiterentwickelt ist. Als Coledowe und Gultsowe
finden sie sich im Zehntenregister von 1230. Es kommt hinzu, daß
beide Siedelungen in dem uralten Schmelzwassertal liegen, das heute die Linau
einnimmt. Dessen magere Sande und Kiese haben wahrscheinlich niemals Wald
getragen und so immer günstige Siedelungsmöglichkelten geboten. Weiter westwärts
kommen slavische Dorfnamen nicht mehr vor. Es kann auch kein Zufall sein, daß
1230 im Zehntenregister noch die ganze Reihe der Dörfer des südlichen
Waldrandgebietes fehlt: Schwarzenbek. Brunstorf, Dassendorf, Kröppelshagen,
Wohltorf, ebenso weiter südlich Börnsen und Escheburg. Nur vom Südosten her war
1230 die Rodung
1927/1 - 14
1927/1 - 15
schon über die slavische Siedelungsgrenze hinaus
im Vorrücken: Dörfer Geesthacht und Hohenhorn waren schon Kirchdörfer, neben
ihnen werden Wiershop, Hamwarde, Worth, Hasenthal, Besenhorst - letzteres damals
noch am Elbufer gelegen, erst im 19. Jahrhundert verlegt -,
endlich als westlichster Vorposten Fahrendorf bei Hohenhorn erwähnt. Wir haben
allerdings keine ausdrücklichen geschichtlichen Nachrichten darüber, wie weit zu
den verschiedenen Zeiten die Waldbedeckung des Landes gereicht hat. Aber es gibt
doch wohl die Möglichkeit, die Verschiebung der Waldgrenzen in den einzelnen
Zeitperioden in der Hauptsache festzustellen. Man hat auszugehen von der Frage:
wo hat sich ursprünglich ohne menschliches Zutun auf Grund der
Bodenbeschaffenheit bei dem jeweils in unserem Lande herrschenden Klima Wald
entwickeln müssen? Man nehme etwa die Skizze, die Hermann Hovemeister im
56. Band der Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische
Geschichte (Kiel 1926) auf Seite 110 nach C. Gagels
Karte in den Erläuterungen zur geologischen Karte Lieferung 140
(Berlin 1915) veröffentlicht hat. Hofmeister, der verdiente
Erforscher unserer vorzeitlichen Burgen und Befestigungswerke, behandelt hier
die Frage des von mir oben erwähnten Limes Saxoniae oder
Saxonicus, der die Sachsenmark Sadelbande vom Gebiet der freien Polaben
schied, und sucht den ehemaligen Delvunderwald zu bestimmen, durch den der
Grenzzug verlief, bevor er die Delvenau erreichte. Nun handelt es sich bei den
uns dem Namen nach bekannten Urwäldern der alten Zeit, wie dem Trave-Wald
nördlich Oldesloe, dem Isarnho, der sich durch Holstein bis an die Schlei
erstreckt, und dem Klützer Wald um sogen. Moränenlandschaften mit fettem
Lehmboden, um sogen. "Buchenböden". "Es ist bewiesene Erkenntnis", schreibt
Hofmeister unter Berufung auf die grundlegenden Vorarbeiten des Archäologen Dr.
Tode in Kiel, „daß sich die steinzeitlichen Siedelungen und Denkmäler
auffallender Weise in dürrer, magerer Sandgegend finden. Den fetten Boden mußten
die Steinzeitleute liegen lassen, weil er von einem anderen Herren, der
mächtiger war, mit Beschlag belegt war. Das war der Wald - und der Mensch besaß
bis in die Zeit der Christianisierung hinein keine Möglichkeit, mit dem Walde
aufzuräumen. Selbst als er während der bronzeeiszeitlicen Trockenperiode, als
der Wald der Dürre wegen schwand und lichter wurde, in früheres Waldgebiet
eingedrungen war, wurde er daraus wieder vertrieben, sobald die
Vegetationsverhältnisse sich besserten und der Wald sich wieder ausbreitete. Der
Wald war eben mächtiger und anspruchsvoller als der Mensch." Nun findet man auf
der mecklenburgischen Seite der Elbe-Trave-Kanalniederung, der alten Delvenau,
ein breites sogen. "Sandr-Feld", wie der Geograph jene flache, unfruchtbare
Landschaft nennt, die dadurch entstand, daß die Schmelzwässer nach der Eiszeit
mächtige Sandmassen ausspülten, auslaugten und damit das Vorgelände der sogen.
Endmoräne, d. h. der Aufschüttung am abschmelzenden Ende der eiszeitlichen
Gletschermassen, überschütteten. Der lose Sand lagert dort in einer Dicke von
zwölf bis zwanzig Metern. Er besteht aus fein zerriebenem Quarz, ist arm an
Nährsalzen und in hohem Grade wasserdurchlässig. Infolgedessen
1927/1 - 15
1927/1 - 16
gibt er einen dürren, unfruchtbaren Boden ab.
Dieses Sandr-Feld, das südlich von Gudow sich bis Boitzenburg erstreckt, bildet
westlich der Kanalniederung einen verhältnismäßig schmalen Streifen, der im
Osten sich etwa von Roseburg bis Pötrau in die Breite ausdehnt, von da westwärts
die Bahnlinie Büchen-Schwarzenbek-Friedrichsruh auf der nördlichen Seite
begleitet, so daß heutzutage der größere Teil des Sachsenwaldes auf diesem
Sandr-Streifen steht. Aber war das immer so? Nach seiner natürlichen
Beschaffenheit muß gerade derjenige Teil des Kreises, der südlich der Bahnlinie
Büchen-Schwarzenbek-Friedrichsruh liegt, als alter Waldboden angesprochen
werden. Ebendort hat ja nach Adam von Bremen bei der alten Grenzsetzung im
9. Jahrhundert auch der Delvunderwald gelegen. Nördlich der Bahnlinie
ist der ganze Sandr-Streifen bedeckt mit durchweg slavisch benannten Rundlingen.
Nur vereinzelte deutsch benannte - wahrscheinlich nachträglich deutsch
UMbenannte Rundlinge wie Havekost, das alte "Habichtshorst" - ein in Holstein
sehr beliebter Dorfname - und Elmenhorst sind darunter. Dies muß uraltes, weil
urwaldfreies, Siedelungsgebiet sein. Von hier muß sich die Siedelung durch
Rodung südwestwärts vorgeschoben haben. Am Ende der Slavenzeit waren ihre
vorgeschobensten Posten nach Westen zu ungefähr Kollow-Gülzow-Krukow-Tesperhude
(das alte Toschope). Doch kann von der heutigen Dichte der Verbreitung
menschlicher Siedlungen in der lauenburgischen Südecke noch ums Jahr 800
nach Christi Geburt keine Rede gewesen sein. Wird doch die sächsische Grenzmark
der im Jahre 818 zum ersten mal erwähnte Limes Saxonicus
- als deutsche Grenze durch slavisch besiedeltes Land so angelegt, daß
zwischen dem Elbübergang Artlenburg-Ertheneburg und dem Flusse Delvunda, der
Delvenau, die nach Hofmeisters Forschungen wahrscheinlich von Witzeeze nordwärts
bis einen Kilometer südlich von Grambek als Grenzgraben benutzt wurde, der
Delvunderwald als Grenzwildnis diente. Hier war also 818 noch
ausgedehnter unwegsamer Urwald. Hier ist auf den Namen des Dorfes Buchhorst bei
Lauenburg - im Zehntenregister um 1230 als Bochorst
(zu lesen: Bok-horst) aufgeführt - hinzuweisen. Für diese Gegend fanden also
noch die deutschen Kolonisten den Buchenwald bezeichnend. Nebenbei sei bemerkt,
daß Buchen schwerlich etwas mit dem deutschen Wort "Buche" zu tun hat, sondern
slavisch sein dürfte.
Aber warum fehlt dem Lauenburgischen die Form des Hagendorfes, obwohl doch um
den Sachsenwald herum unzweifelhaft manche der heutigen Dörfer in den Wald erst
in der Zeit der deutschen Einwanderung hineingerodet worden sind? Warum haben
hier noch in der Zeit der deutschen Kolonisation Einwanderer aus Niedersachsen
und Westfalen, wo man keine Rundlinge kennt, die uralte Rundform angewandt?
Wahrscheinlich taten sie es, weil ihnen die lockere Reihe des Waldhufendorfes in
diesem ziemlich dicht wendisch besiedelten und daher in der Frühzeit
Kolonisation nicht als sicher anzusprechenden Bezirk nicht die genügende
Sicherheit gegen räuberische Überfälle auf das eine oder andere Einzelgehöft
bot. Der Rundling war zwar keine militärisch verteidigungsfähige Festung, machte
es einer Bande aber doch ziemlich unmöglich, ein Gehöft auszuplündern oder das
Vieh
1927/1 - 16
1927/1 - 17
vom Dorfanger wegzutreiben, bevor die Hilfe der
Nachbarn zur Stelle war. Es ist sehr bezeichnend, daß die oben erwähnten
mecklenburgischen Hagenrundlinge nicht in dem Zusammenhang der deutschen
Hagendörfer des Küstengebietes, sondern abseits im Binnenlande zwischen
Wendendörfern ziemlich vereinzelt lagen.
Sind somit die Runddörfer zwar in verschiedenen Zeiten angelegt, ihre Form aber
offenbar sehr alt, vermutlich bereits in die vorgeschichtlich Zeit unserer
Hünengräber zurückreichend - sind dagegen Wald- und Marschhufendörfer auch ihrer
Form nach eine junge Bildung der Kolonisationszeit, so liegt die Entstehung der
nunmehr noch übrigen STRASZEN- und ANGERDÖRFER der Zeit nach in der Mitte. Auch
ihre Gestalt ist ein Mittelding zwischen dem gedrungenen Rundling und dem weit
auseinandergezogenen Wald- und Marschhufendorf. Längs einer ziemlich kurzen
Dorfstraße, und zwar stets auf BEIDEN Seiten liegen eng aneinander die Gehöfte
(vgl. das Straßendorf Fuhlenhagen Abb. 2). Natürlich kann bei
solcher Anordnung der Gehöfte das Land der zugehörigen Hufe nicht in einem
zusammenhängenden Stücke in unmittelbarer Nähe liegen, sondern ist über die
ganze Feldmark verstreut.
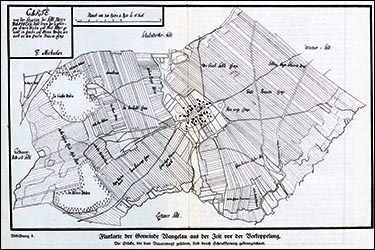
Abbildung 4.
Flurkarte der Gemeinde Wangelau aus
der Zeit vor der Verkoppelung.
Die Stücke, die dem Bauernvogt gehören, sind durch Schraffierung
gekennzeichnet.
Weitet sich die Dorfstraße zu einem länglichen Platze
wie in Wangelau (Abb. 4), so haben wir das sogen. Angerdorf, das
dem Rundling noch ein Stück näher steht als das Straßendorf, zumal wenn die
Landstraße nicht durch das Dorf hindurch, sondern daran vorbeiführt, so daß der
Dorfanger eine Sackgasse bildet. Dörfer dieser Form beherrschen das ganze weite
slavische Siedelungsgebiet bis an den Ural, dagegen ist in Westdeutschland diese
kurze gedrungene Dorfform nicht gewöhnlich. Über den slavischen Ursprung dieses
Typus besteht daher keinerlei Zweifel. Aber wie der Rundling ist auch das
Straßendorf, insbesondere das Angerdorf gerne von den deutschen Kolonisten bei
neuen Anlagen als Vorbild gewählt worden, vermutlich aus demselben Grunde:
Besorgnis vor räuberischen Überfällen und Bedürfnis schneller Nachbarhilfe im
unsicheren Slavenlande.
Beachtenswert ist, daß die Dörfer mit der Vorsilbe "Klein-" alle Straßendörfer
sind. Gerade diese Dörfer aber sind die jüngsten rein-slavischen Gründungen; es
sind "Flüchtlingsdörfer" in dem Sinne, daß nach einem in Ostdeutschland vier
angewandten Verfahren bei vielen Dörfern der deutsche oder slavische Grundherr
von seinem Kündigungsrecht gegenüber den slavischen Bauern Gebrauch machte, den
größeren Teil der Feldmark zu deutschem Rechte austat (ob an Leute deutscher
oder slavischer Abkunft, ist hier einerlei) und den weichenden Slaven
anheimstellte, sich auf dem kleineren und meist auch der Bodengüte nach
minderwertigen Teil der Flur neu einzurichten. Ausdrücklich bezeugt ist uns, wie
oben schon erwähnt, der slavische Ursprung bei Kl. Thurow, Kl. Zecher, Kl.
Berkenthin, Kl. Pampau im Zehntenregister von 1230. Dazu kommt Kl.
Klinkrade, das 1337 als clincroth slavicalis
erscheint. Alle diese Dörfer finden sich im nördlichen Teile des Kreises, nur
Kl. Pampau liegt südlich der Kreismitte, aber immerhin noch weit entfernt vom
Südrand des lauenburgischen Gebietes.
1927/1 - 17
1927/1 - 18
Diese Tatsache bestätigt die vorhin aufgestellte Ansicht, daß im
Süden z. Zt. der deutschen Einwanderung noch soviel Wald auf gutem Lehmboden
frei war, daß die deutschen Kolonisten genügend Platz fanden und in dem
Sandr-Streifen nördlich der Hamburg-Büchener Bahn die Slaven ruhig sitzen
ließen, weil der Boden den anspruchsvollen deutschen Siedler nicht lockte.
Südlich der Bahn liegt kein einziges "Klein"-Dorf, im Sandr-Gebiet nur Kl.
Pampau. Daß aber auch die Deutschen das Straßendorf noch angewandt haben,
beweist außer dem Walddorf Fuhlenhagen auch z. B. die große Siedelung
Breitenfelde, die schon 1230 als Kirchdorf Bredenvelde erscheint.
So stellt sich uns das Bild der Entstehung unserer lauenburgischen Dörfer zwar
noch nicht in allen Punkten völlig geklärt, aber formen- und farbenreich als der
Fortschritt menschlicher Arbeit in der Bewältigung der wilden Natur dar, und wir
dürfen mit Stolz feststellen, daß die Lösung der schwierigsten Aufgaben, der
Bemeisterung des Urwaldes im Süden des Kreises, wie der Wasserwüste des Elbtales
erst deutscher Tüchtigkeit vorbehalten geblieben ist.
* * *

|